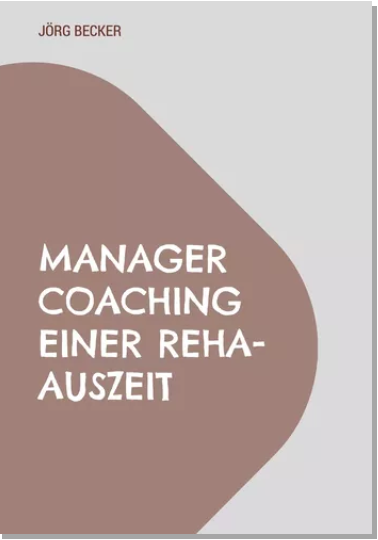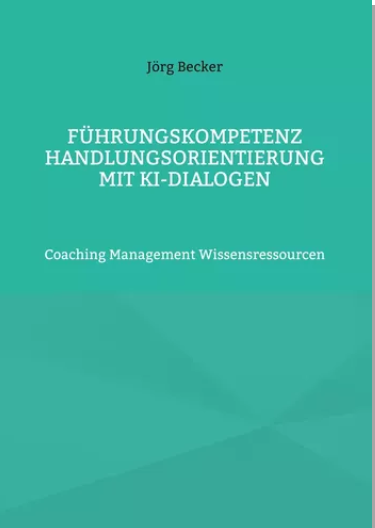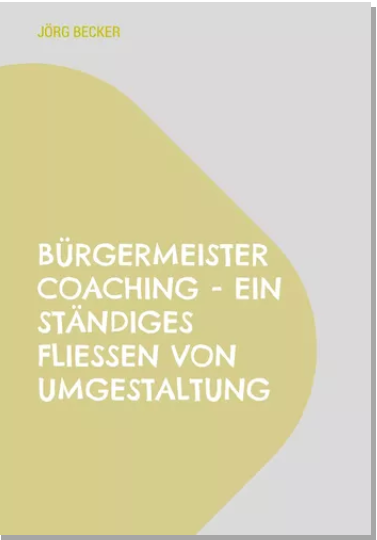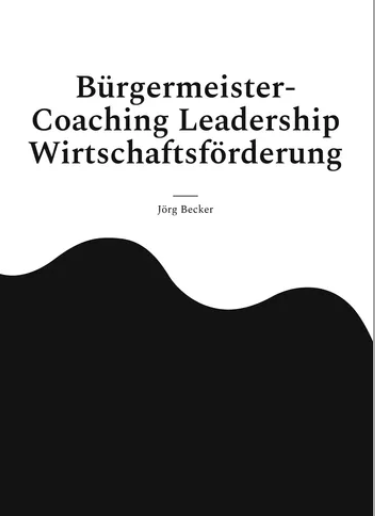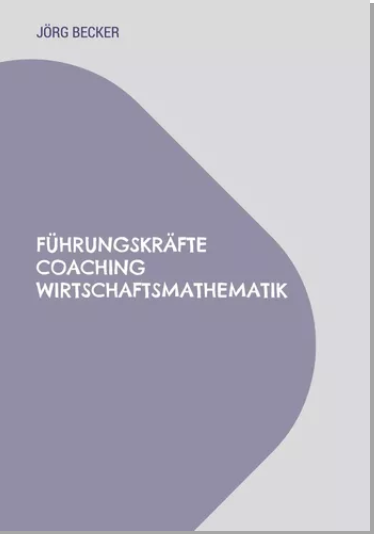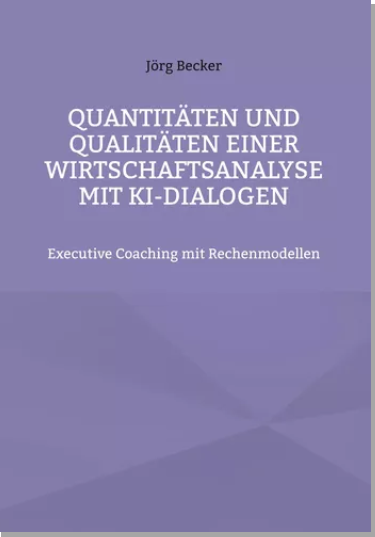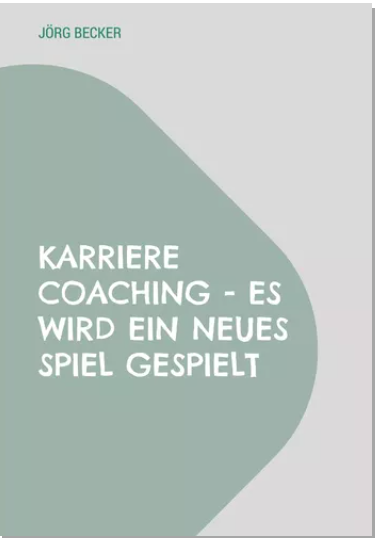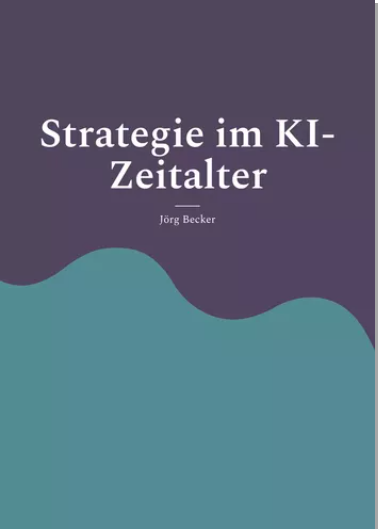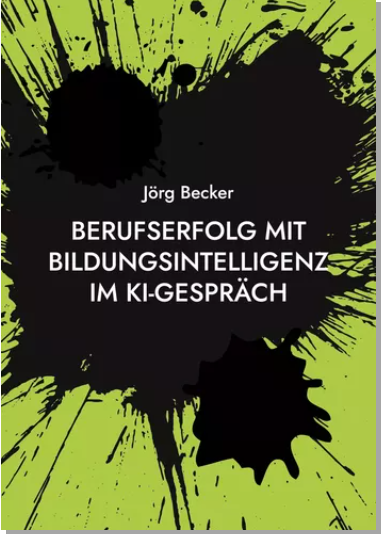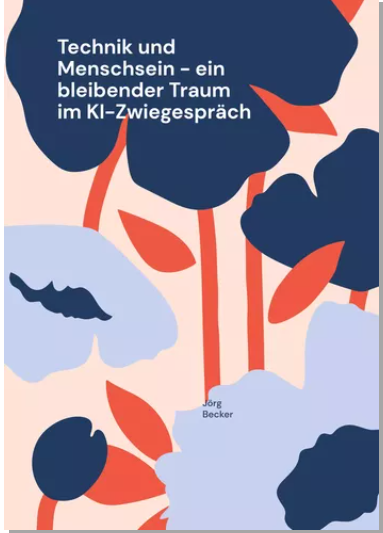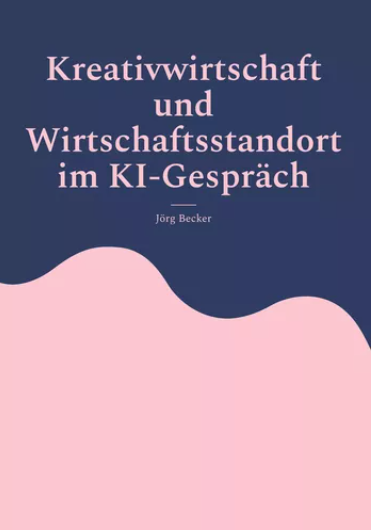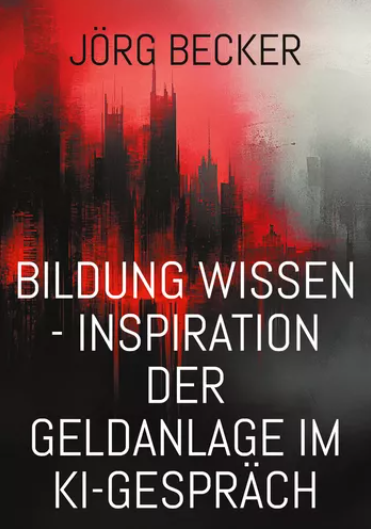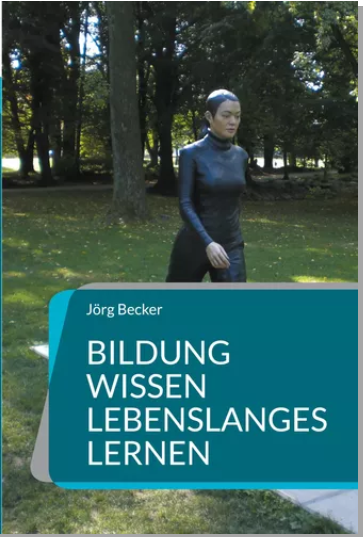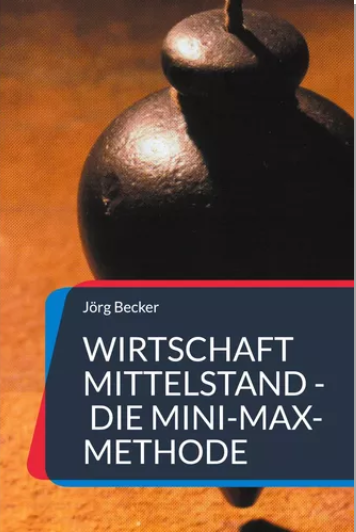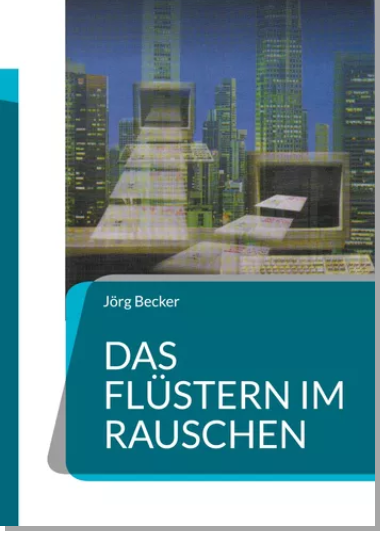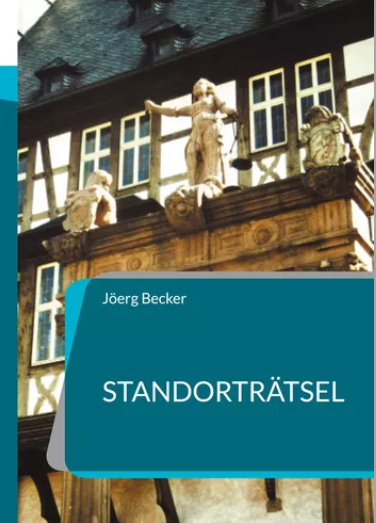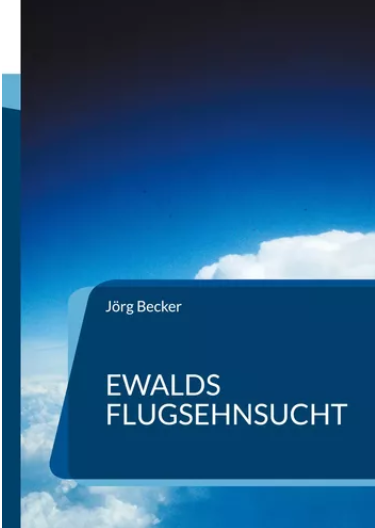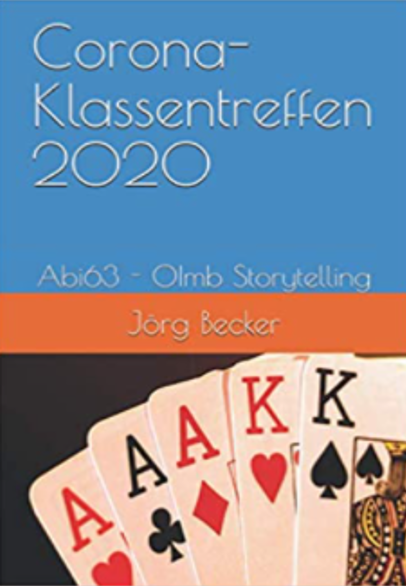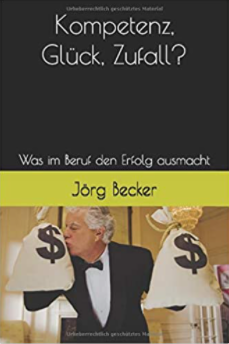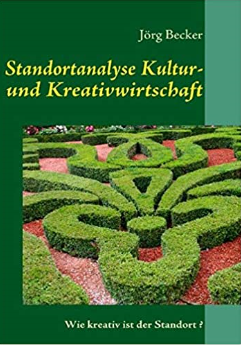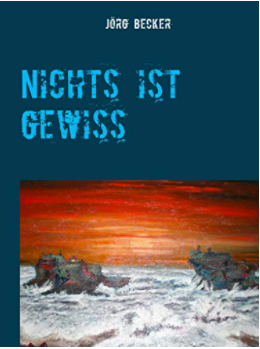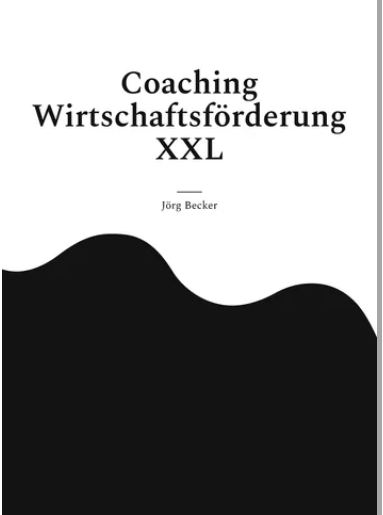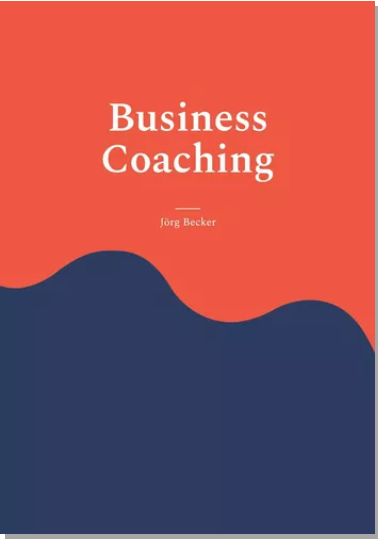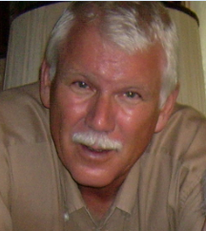SALVE,
Nichts ist mehr so wie es war………………..
Führungskräfte in Politik und Wirtschaft stehen vor der Aufgabe, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, die oft weitreichende Konsequenzen haben. Die Beherrschung mathematischer Grundsätze zur Berechnung von Risiken und Wahrscheinlichkeiten bietet ihnen essenzielle Werkzeuge, um diese Entscheidungen fundierter und nachvollziehbarer zu gestalten.
Quantitative Entscheidungsgrundlage
Risiken mathematisch zu erfassen ermöglicht eine objektive Analyse, statt sich allein auf Intuition oder unstrukturierte Einschätzungen zu verlassen.
Modelle wie die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Risikobewertungen oder Kosten-Nutzen-Analysen helfen, komplexe Szenarien in messbare und vergleichbare Größen zu überführen.
Strategisches Risikomanagement
In Politik und Wirtschaft sind Risiken nicht immer vermeidbar, aber sie können bewältigt werden. Mathematische Methoden wie Monte-Carlo-Simulationen, Entscheidungsbäume oder Value-at-Risk-Modelle helfen, verschiedene Handlungsalternativen unter Risiko zu bewerten.
Dadurch können Führungskräfte Strategien entwickeln, um Verluste zu minimieren oder Chancen gezielt zu nutzen.
Verantwortung und Transparenz
Mathematische Modelle schaffen Transparenz über die Annahmen, die einer Entscheidung zugrunde liegen. Dies ist besonders in der Politik wichtig, um Entscheidungen der Öffentlichkeit und den Medien plausibel zu erklären.
Führungskräfte, die Risiken fundiert berechnen können, tragen eine größere Verantwortung, da sie sich nicht auf „unkalkulierbare“ Unsicherheiten berufen können.
Vorbereitung auf Extremszenarien
Extreme Risiken wie Naturkatastrophen, Finanzkrisen oder Pandemien sind schwer vorhersagbar, aber mathematische Methoden wie Szenario-Analysen oder Extremwerttheorien ermöglichen es, Worst-Case-Szenarien einzuschätzen.
Diese Vorbereitung ist entscheidend, um Resilienz aufzubauen und handlungsfähig zu bleiben.
Effizientere Ressourcenzuteilung
In Wirtschaft und Politik sind Ressourcen wie Zeit, Geld und Personal oft knapp. Mathematische Modelle ermöglichen es, diese Ressourcen gezielt dort einzusetzen, wo sie den größten Nutzen bringen – sei es durch Optimierung oder Risikominimierung.
Komplexität der Finanzwelt
Die Finanzwelt ist stark mathematikgetrieben, da sie sich mit Wahrscheinlichkeiten, Renditen und Risiken befasst. Führungskräfte, die mit diesen Konzepten vertraut sind, können besser verstehen, wie Finanzprodukte, Versicherungen oder Investitionen funktionieren.
Sie sind zudem besser gerüstet, Risiken aus Spekulationen oder Marktunsicherheiten zu bewerten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Das heißt:
Mathematische Grundsätze zur Berechnung von Risiken und Wahrscheinlichkeiten sind essenziell für Führungskräfte, weil sie helfen, Unsicherheiten zu strukturieren, Entscheidungen zu optimieren und Verantwortung bewusst zu übernehmen. Angesichts der wachsenden Komplexität und Unsicherheit in der Welt sind diese Fähigkeiten unverzichtbar, um nachhaltige, transparente und resiliente Entscheidungen zu treffen.
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
Executive Coaching
Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
https://buchshop.bod.de/fuehrungskraefte-coaching-wirtschaftsmathematik-joerg-becker-9783758371646
Im Angesicht des Risikos hängt die Rationalität einzelner Entscheider von ihrem Wertesystem ab. Demzufolge kann ihr Verhalten dem zuwiderlaufen, was die Gesellschaft von ihnen erwartet und was lediglich das Spiegelbild einer gewissermaßen als Durchschnitt ermittelten Rationalität ist. Über ihr ausgewogenes oder unausgewogenes Wesen hinaus werden die Risiken nicht in allen Bereichen immer auf dieselbe Weise wahrgenommen oder bewertet. Abhängig von bestimmten Personen oder Gruppen werden bestimmte Risiken unterschiedlich erhellt, verschleiert oder mit voneinander abweichenden zeitlichen Dimensionen und Wertigkeiten vermessen. Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, wie schwer es ist, eine Gesellschaft für Risiken, die nie zuvor Bestandteil ihres Alltagslebens waren, empfänglich zu machen. Eine Mathematisierung von Risiken bedeutet immer, Dingen einen Preis beizumessen, die keinen haben: dem Leben, der Gesundheit, dem Wohlbefinden, der Zufriedenheit und so weiter. Die Lebensversicherung ist die erste bedeutende Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Noch vor Ende des 17. Jahrhunderts wurden die ersten Sterbetabellen berechnet, mit deren Hilfe man die Wahrscheinlichkeit der Lebensdauer abschätzte.
Bei vielen Problemen sind mathematische Modelle ein war nützliches, aber dennoch nur begrenztes Entscheidungsinstrument. Eine gewisse Zahl von Problemen bleibt also deshalb unberechenbar, weil es nicht möglich ist, auf einer halbwegs rationalen Grundlage eine Größenordnung für die Wahrscheinlichkeit anzugeben, mit der die bedrohlichen Ereignisse der Katastrophenszenarien eintreten. Dennoch bestehen derartige Risiken, die ein Gefühl der allgemeinen Unsicherheit verstärken. Schließlich ist es auch ausgeschlossen, eine ganze Reihe von nahezu alltäglichen Problemen, die nach Meinung vieler Menschen Risikofaktoren darstellen, in eine Modellform zu bringen. Trotzdem gibt es in der Praxis eine Vielzahl von Normen und Bestimmungen, die auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen beruhen. Beim Bau des Überschall-Passagierflugzeuges Concorde wurde als Zielvorgabe festgesetzt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes nicht 1 : 10 000 000 pro Flugstunde übersteigen darf. Diesen Wert ermittelt man auf der Grundlage von Statistiken der Flugzeugunglücke älterer Flugzeugtypen berechneter Wahrscheinlichkeiten, die man um den Faktor 10 anhob. Für den T.G.V. wurde vorgeschrieben, die Unfallwahrscheinlichkeit auf weniger als 1 : 1 000 000 000 pro Betriebsstunde zu senken.
https://buchshop.bod.de/fuehrungskraefte-coaching-wirtschaftsmathematik-joerg-becker-9783758371646
 Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz
Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz