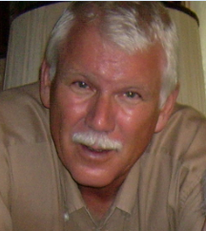SALVE,
Nichts ist mehr so wie es war………………..
Der berufliche Aufstieg ist in der modernen Arbeitswelt oft schwieriger geworden, da sich die Anforderungen und Rahmenbedingungen stark verändert haben. Es gibt verschiedene Hürden und Barrieren, die Menschen auf dem Weg zum Erfolg begegnen können, aber auch Qualifikationen und Eigenschaften, die den Aufstieg fördern.
Wirtschaftliche Unsicherheit: Die Globalisierung und technologische Entwicklungen haben viele Branchen disruptiv verändert. Viele Menschen sehen sich mit einer ungewissen wirtschaftlichen Zukunft konfrontiert, was die langfristige Planung und berufliche Sicherheit erschwert. Beispiel: In der Automobilbranche werden Arbeitsplätze durch die Umstellung auf Elektromobilität und Automatisierung bedroht, was vielen qualifizierten Arbeitskräften ihre traditionelle Karriereperspektive nimmt.
Bildung und Zugang zu Ressourcen: Die Chancen auf beruflichen Aufstieg hängen oft vom Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung und Netzwerken ab. Menschen aus sozioökonomisch schwächeren Verhältnissen haben oft schlechtere Startbedingungen. Beispiel: Studien zeigen, dass Kinder aus wohlhabenderen Haushalten häufiger bessere Schulen besuchen, Praktika in angesehenen Unternehmen absolvieren und so wertvolle Netzwerke aufbauen können.
Soziale Ungleichheit und Diskriminierung: Geschlecht, ethnische Herkunft und soziale Klasse können erhebliche Hürden darstellen. Trotz Fortschritten erleben Frauen und Minderheiten oft Ungleichbehandlung, die ihren Zugang zu Führungsposten behindern. Beispiel: Frauen sind in Führungspositionen oft unterrepräsentiert und verdienen im Durchschnitt weniger als Männer in vergleichbaren Positionen. Auch ethnische Minderheiten sind oft mit Vorurteilen und struktureller Benachteiligung konfrontiert.
Technologische Veränderungen: Die fortschreitende Digitalisierung erfordert neue Fähigkeiten und Kenntnisse. Wer nicht bereit ist, sich stetig weiterzubilden, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Beispiel: In der IT-Branche entstehen ständig neue Programmiersprachen und Technologien. Fachkräfte, die sich nicht regelmäßig weiterbilden, riskieren, dass ihre Qualifikationen veraltet sind.
Erfolgsfaktoren und Qualifikationen
Bildung und lebenslanges Lernen: In einer sich schnell verändernden Arbeitswelt ist die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung entscheidend. Eine solide Grundausbildung ist wichtig, aber das kontinuierliche Erlernen neuer Fähigkeiten, insbesondere im Bereich der Technologie, ist entscheidend. Beispiel: Menschen, die zusätzliche Qualifikationen in aufstrebenden Bereichen wie Künstlicher Intelligenz oder Datenanalyse erwerben, haben oft bessere Chancen, in ihrem Bereich erfolgreich zu bleiben oder aufzusteigen.
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Wer in der Lage ist, sich auf neue Herausforderungen einzustellen und flexibel auf Veränderungen zu reagieren, hat größere Chancen auf beruflichen Erfolg. Beispiel: Während der COVID-19-Pandemie mussten viele Unternehmen ihre Arbeitsweise auf Remote-Arbeit umstellen. Mitarbeitende, die sich schnell an diese neue Realität anpassen konnten, waren in der Lage, ihre Position zu halten oder sogar neue Chancen zu ergreifen.
Netzwerkaufbau und Beziehungen: Beruflicher Erfolg hängt oft von den richtigen Verbindungen ab. Menschen, die aktiv Netzwerke aufbauen und pflegen, haben bessere Chancen auf interessante Karrierechancen. Beispiel: Führungskräfte und Unternehmer berichten häufig, dass viele Karrieremöglichkeiten durch Empfehlungen oder informelle Netzwerke entstehen, nicht nur durch herkömmliche Bewerbungsverfahren.
Resilienz und Durchhaltevermögen: Rückschläge sind unvermeidlich, und Menschen, die in der Lage sind, sich von Misserfolgen zu erholen und weiterhin an ihren Zielen zu arbeiten, haben langfristig größere Chancen, erfolgreich zu sein. Beispiel: Viele erfolgreiche Unternehmer wie Elon Musk oder Jeff Bezos haben in den frühen Stadien ihrer Karriere erhebliche Rückschläge erlitten, aber sie zeigten Durchhaltevermögen und setzten ihre Visionen konsequent um.
Innovationsfähigkeit und Problemlösungskompetenz: Menschen, die in der Lage sind, kreative Lösungen für Probleme zu entwickeln und innovative Ansätze zu finden, werden oft als wertvolle Mitarbeiter angesehen und schneller befördert. Beispiel: In der Technologiebranche werden innovative Denker wie Steve Jobs oder Elon Musk gefeiert, weil sie in der Lage waren, Produkte zu schaffen, die nicht nur Probleme lösen, sondern auch neue Märkte definieren.
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
Executive Coaching
Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
Lotterie mit Gewinn-Verlust-Rechnung als Alternative?
Nehmen wir an, man setzt für ein Lotterielos 1 Euro ein und kann dabei entweder 1 Million Euro gewinnen oder seinen Einsatz verlieren. Spielt man nicht, behält man diesen 1 Euro. Spielt man mit, würde der Durchschnittsertrag annähernd Null betragen. Sollte man also nie bei einer Lotterie mitspielen? Viele Menschen würden intuitiv anderer Meinung sein und bei vielleicht bei einem solchen Lotteriespiel teilnehmen wollen. Denn das Gewinnpotenzial erscheint so groß, dass man für das Mitspielen wohl auch einmal auf ein Bier verzichten würde. Denn würde man verlieren, würde der Verlust wohl nicht weiter schmerzen. Was aber würde bei einer Lotterie mit zwar genau der gleichen Gewinnchance aber einem ungleich höheren Einsatz geschehen: wenn der Preis eines Loses auf 10.000 Euro und der mögliche Gewinn auf 10 Milliarden Euro erhöht werden würden?
Die meisten Menschen würden wohl aus dem Spiel aussteigen, viele könnten sich den Spieleinsatz erst gar nicht leisten. Ausnahme wären vielleicht, die „im Geld schwimmen“. Denn sie könnten nicht nur problemlos die 10.000 Euro für ein Los aufbringen. Ihr Verlustschmerz wäre (trotz minimaler Gewinnchance) vielleicht nicht größer als jener der obigen 1 Euro-Verlierer. Wie ein mögliches Verlustrisiko empfunden wird, hängt demnach ganz von den persönlichen Umständen ab. Gewährt ein Unternehmen seinem Mitarbeiter am Ende eines Geschäftsjahres einen Sonderbonus von 5.000 Euro, wird dieser umso mehr erfreut sein umso weniger er hiermit vorher gerechnet hatte. Hatte er allerdings insgeheim mit einem Sonderbonus von 10.000 Euro gerechnet, so dürfte er vielleicht eher enttäuscht sein. Je höher die Erwartung war, umso größer die nachfolgende Enttäuschung.
Welche Entscheidungen wir jeweils treffen, hängt zum Teil von unseren Erwartungen der möglichen Ergebnisse ab. Und von der Bedeutung, die wir diesen Ergebnissen beimessen. Bei Entscheidungen müssen wir die aktuellen tatsächlichen Kosten gegen den zukünftigen unsicheren Nutzen abwägen. Wie im Lotteriebeispiel aufgezeigt, hängen viele Entscheidungen stark von persönlichen Gegebenheiten ab. Menschen treffen oft Entscheidungen, die nach außen hin seltsam erscheinen. Man hat es mit unterschiedlichen Verhaltensweisen und Eigenarten in der Denkweise zu tun, die Menschen dazu bringen, Dinge zu tun, die auf den ersten Blick unlogisch, inkonsistent oder schlichtweg dumm erscheinen. So wie vielleicht viele Privatanleger glauben, den Markt übertrumpfen zu können, obwohl sie in Finanzdingen nur wenig bewandert sind.
 Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz
Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz